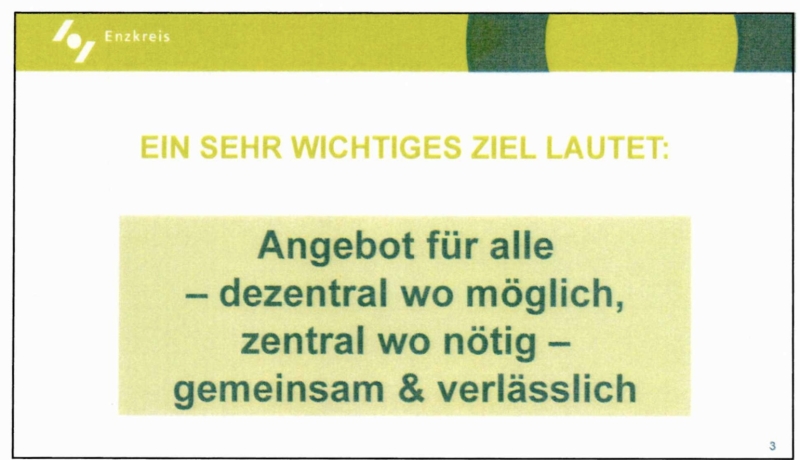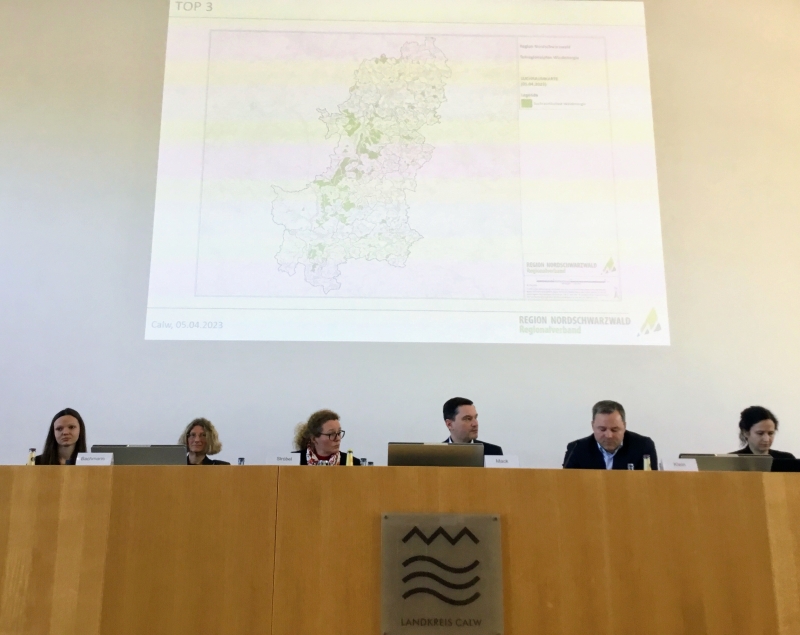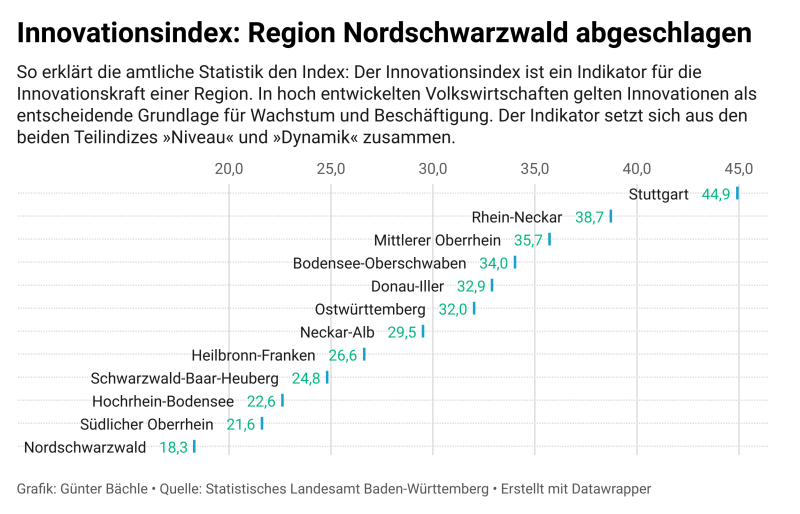Der Enzkreis feiert Geburtstag. Steht heute in der Zeitung. Den Fünfzigsten. Die Kreisverwaltung kündigt 52 Fest-Wochen im Jahr 2023 an unter dem originellen Motto Der Kreis mit schönen Ecken. In petto Serien von Podcasts, Videos, Texten – und ein Actionfilm! Was genau lässt sich nur raten, erahnen, vermuten … Jedenfalls fiel mir beim Lesen mein persönliches Jubiläumsstück ein: etwa 12 auf 18 auf 5 Zentimeter, Schatulle, Deckel ganz abzunehmen, aus Keramik, lasiert, im Laufe der Jahre leicht an Glanz verloren. Darauf eingebrannt: Das Wappen des Landkreises Vaihingen/Enz, im oberen Teil der rote Vaihinger Löwe, unten das Mühlrad aus dem Mühlacker Wappen, dazwischen der Maulbronner Schachbalken.
Da steckt Symbolik, aber auch die Tragik dieses Kreises drin. Denn die Rivalität zwischen Mühlacker und Vaihingen erleichterte der Landespolitik, diesen Landkreis 1971 zu zerschlagen, zwischen Pforzheim und Ludwigsburg (und ein bisschen Karlsruhe) aufzuteilen. Das dazu beschlossene Gesetz wirkt seit dem 1. Januar 1973.
Die Schatulle, über deren Schönheit sich streiten lässt, besitzt zumindest einen ideellen Wert. Es war das offizielle Abschiedsgeschenk des Landkreises Vaihingen. Landrat Erich Fuchslocher überließ mir dieses Exemplar. Trotz einer leichten Macke steht das gute Stück seit einem halben Jahrhundert bei mir in Lienzingen hinterm Glas. So gesehen lässt sich daraus eine Lienzinger Geschichte stricken, zumal die Kommune auch am Verfahren beteiligt war. Die Story sprengt jedoch den lokalen, umfasst auch den regionalen Rahmen – bis nach Ergenzingen und Stuttgart. Bringt viel Landespolitik und die Frage, wie sich zum Beispiel die Lienzinger dazu stellten. Denn ich war in den Phasen der Kreisreform journalistisch und politisch aktiv, schrieb über Wirren und Verwirrung beim Ziehen neuer Land- und Stadtkreis-Grenzen. Ein, nein, der Lienzinger Zeitzeugenbericht mit viel persönlichen Ein- und Dreinblicken.
Wie war das eigentlich vor 50 Jahren, als die Großkoalitionäre von CDU und SPD in Baden-Württemberg auf der Landkarte neue Grenzen der Stadt- und Landkreise zogen? Der Kreis Vaihingen war einmal, der Kreis Leonberg auch, trotz des eingängigen Slogans LEO muss bleiben. Eines der dabei entstandenen Konstrukte hieß Enzkreis. Der legt sich wie ein Kragen um den Stadtkreis Pforzheim. Zeit zum Jubiläumsjubel? Was Kreisräte bisher nicht wussten: Das Volk zwischen Neuenbürg und Illingen erwartet 2023 eine Rundum-Fünfziger-Feier. Zwölf Monate ohne Langeweile. Überrascht las ich heute eine Mitteilung aus dem Landratsamt in Pforzheim, dass jetzt die Geburtstagsmaschinerie angeworfen wird und dazu eine Extra-Internetadresse ans Netz geht.
Internet, Mail, soziale Medien – vor 50 Jahren unbekannt. Möglicherweise blieb manche Information 1970/71 deshalb eher in der internen Runde, in den Beratungszirkeln der Fraktionen. Einflussreiche Politiker in Land und Kreis zurrten das Gesamtpaket fest, ungeplantes Öffnen ward nicht erwünscht. Der Landtag hatte einen Sonderausschuss gebildet, der Vaihinger Kreistag eine achtköpfige Sonderkommission. Just die Kommission sollte dem Sonderausschuss in Stuttgart ein Schnippchen schlagen und dessen Teilungspläne für den Landkreis Vaihingen durchkreuzen. Fast hätte es die VAI-Task Force geschafft! Fast?
Lienzinger Geschichte(n) heute in einem größeren Zusammenhang. Denn die Lienzinger mussten vom 1. Januar 1973 an, wenn sie zum Beispiel einen Bauantrag stellten, nicht mehr nach Vaihingen, sondern nach Pforzheim. Wie nahmen sie die Kreisreform auf? Nebenbei Frage in der Blog-Serie: Was hatte unser Ort mit Ergenzingen zu tun? Persönliches verwebt mit Politischem der lokalen und regionalen sowie landespolitischen Ebene. Zusammenhänge werden hoffentlich deutlich
Das Fazit vorab: Zeitweise zweifelte seinerzeit der Betrachter doch heftig an der Fähigkeit mancher Menschen zum fairen und sachlichen Disput. Demokratie geht anders, selbst bei einem so kontroversen Fall wie einer Kreisgebietsreform. Die Realitäten damals: Beleidigungen, Geschmacklosigkeiten, Diskussionsverweigerung, persönliche Herabsetzung vor Ort - besonders zwischen der zweiten und dritten Lesung des Gesetzes im Landtag und dem Streit darüber, ob der ganze Kreis Vaihingen zu Pforzheim geschlagen wird. Ein politischer Prozess, bei dem nicht wenige der lokalen Meinungsführer gerade im Bereich Vaihingen versagten, sonst hätte es die politische Entgleisung mit dem Aufbau eines Galgen vor dem Landratsamt in der Vaihinger Franckstraße nicht geben dürfen. Das muss offen gesagt werden. Auch nach mehr als einem halben Jahrhundert.
"Der Sündenfall vom Juli 1971: Nach zwei Wochen platzte in der dritten Lesung doch noch der Traum vom Großkreis Pforzheim/Vaihingen " vollständig lesen