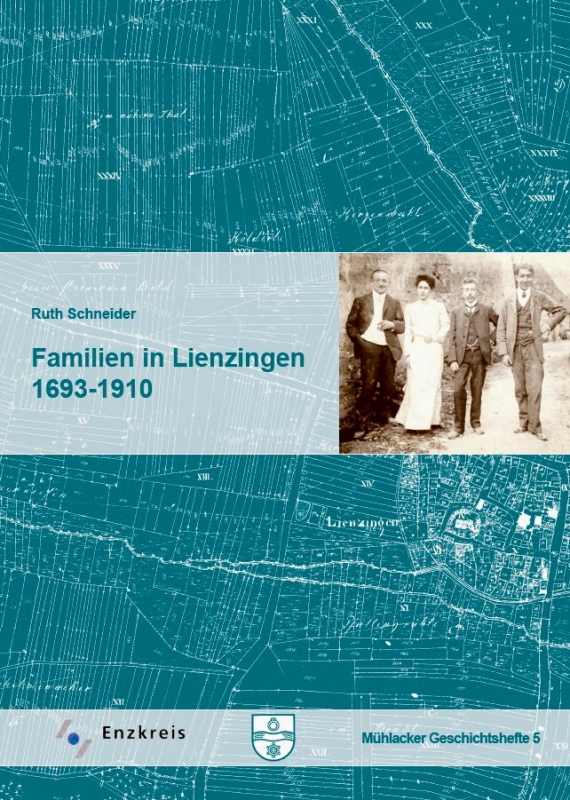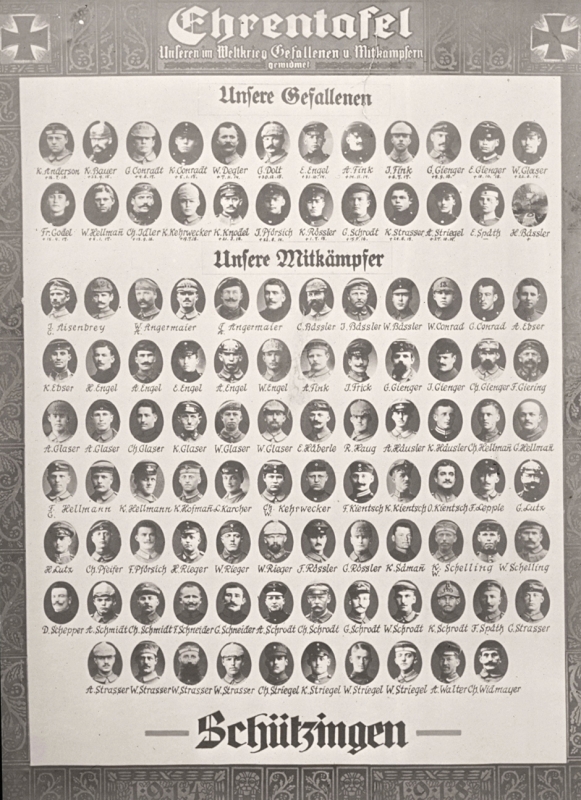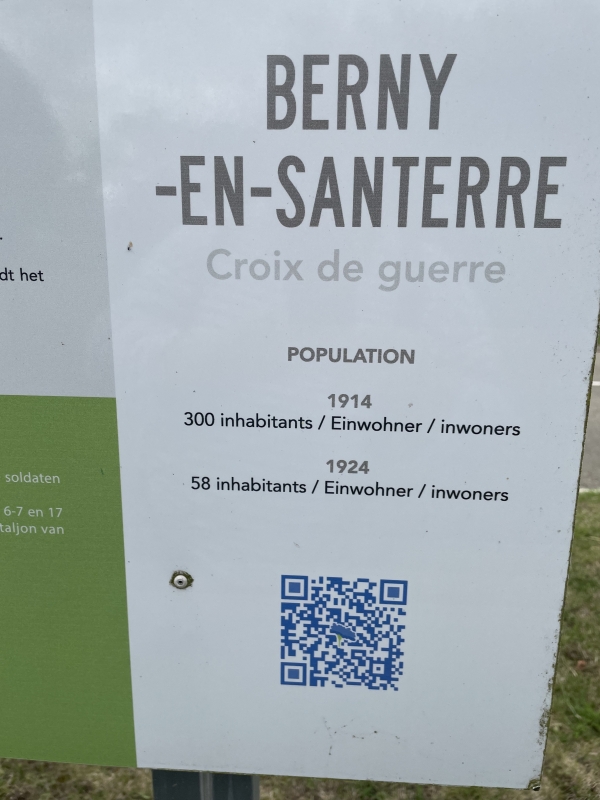Lienzingens historischer Ortskern mit seinen gut erhaltenen mittelalterlichen Strukturen gelte als ein Sonderfall gerade bei jenen Stellen der Landesverwaltung in Karlsruhe und Stuttgart, die sich mit Sanierungsprogrammen beschäftigen und zu deren Beritt der 2100 Einwohner zählende Stadtteil Mühlackers gehört. Das sagte jüngst eine Expertin in puncto Sanierungen.
Lienzingen, der Sonderfall, der nicht mit den üblichen Maßstäben zu messen sei. Das zeigte sich auch, als Bund und Länder 50 Jahre Städtebauförderung feierten. Zu den 50 Musterbeispielen aus Baden-Württemberg gehörten Lienzingen und seine 85 Kulturdenkmale. Fazit des Landes: Mit Hilfe der Städtebauförderung konnte das historische Ortsbild erhalten und die vorhandenen Strukturen zeitgemäß weiterentwickelt werden.
Und weiter lobt das Land unser Dorf:
Der Stadtteil Lienzingen in Mühlacker mit seinem dörflichen Charakter besteht aus einem fast geschlossenen Scheunengürtel mit zahlreichen Fachwerkhäusern. Mit Hilfe der Städtebauförderung konnte diese historische Ortsanlage erhalten und zahlreiche denkmalpflegerisch wertvolle Gebäude modernisiert werden. Funktionslose Scheunen konnten umgenutzt und rückwärtige Bereiche erschlossen werden. Auch viele Gassen und Wege, Grünflächen sowie der Vorplatz der Festhalle wurden neugestaltet. Das Rathaus sowie die Kelter wurden saniert; im Rathaus ist nun das Heimatmuseum untergebracht. Zwischen 2008 und 2011 wurde zudem im Rahmen des Bund-Länder-Programms Investitionspakt energetische Modernisierung sozialer Infrastruktur die Festhalle energetisch und baulich saniert.
Der Sonderfall sei hoch angesiedelt, wird erzählt. Der Sonderfall beschäftigte diese Woche auch den Gemeinderat.
Ein Programm der guten Taten.
Eine Gebäudesanierung, zumal bei einem Kulturdenkmal, kostet häufig beträchtliche Summen. Gut, dass Land und Bund einen Teil der finanziellen Lasten mittragen, einmal über Zuschüsse aus den gemeinsamen Modernisierungsprogrammen mit den Kommunen, zum anderen über zehn Jahre durch erhöhte steuerliche Abschreibungssätze für die Hauseigentümer. Auch wenn an den Immobilienbesitzern trotzdem eine erkleckliche Summe hängen bleibt - diese Art der Subventionen durch die öffentliche Hand hilft wenigstens tragen. Ohne solche Hilfen wären manche Häuser im historischen Ortskern von Lienzingen nicht zu Schmuckstücken herausgeputzt worden wie es seit 2006 der Fall ist. Lienzingen steht auf der Liste der erfolgreichen Sanierungsgebiete unter anderem mit der Bahnstadt in Heidelberg, der Bodan-Werft in Kressbronn am Bodensee und dem Dörfle in Karlsruhe.
"Das spart Lienzingen ein kleines Baugebiet auf der grünen Wiese: 4,7 Millionen Euro von Land und Stadt für einen vitalen Ortskern " vollständig lesen