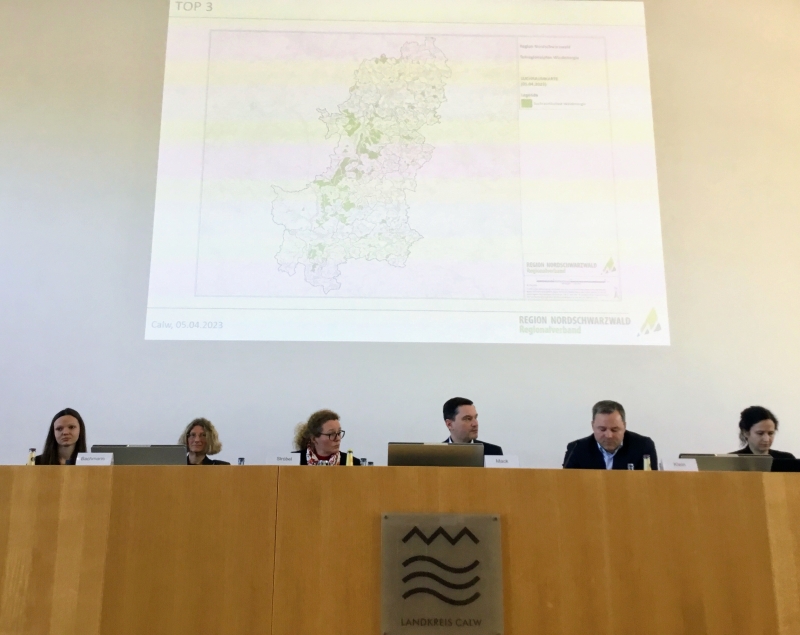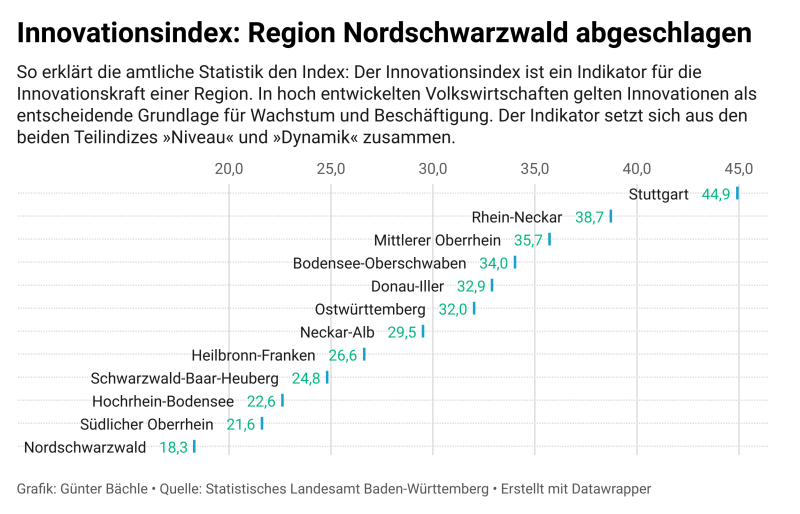Übermannshohe schwarze Kugel aus gefilzter Merinowolle rollt durch Lienzingen
Leverkusen, Hongkong, Rotterdam, Liverpool, Nairobi, Lienzingen – all diesen Orten ist eines gemeinsam: Schauplatz (gewesen) zu sein von Projekten der in den Niederlanden lebenden und in Karlsruhe geborenen Künstlerin Yvonne Dröge Wendel. 1994 gewann sie für Black Ball den zweiten Preis des Prix de Rome im Bereich Bildende Kunst. Ihr Schwarzer Ball rollt nun im Rahmen der Pforzheimer Ornamenta 2024 durch die Region Nordschwarzwald mit dem Haltepunkt Lienzingen Mitte August. Einen Vorgeschmack gab es jetzt beim Treffen von Herzenssache Lienzingen.
Einen ganz Tag im 2100-Einwohner-Dorf. Freie Bahn für den Ball.
Dreieinhalb Meter groß, handgefilzt, ein Objekt ohne Eigenschaften, wie Monika Heinzmann im kleinen Saal der Gemeindehalle sagte. Die Route solle noch Raum lassen für Spontanität, Interaktion und Dynamik. Durch die Bewegung im öffentlichen Raum verbinde der monumentale Ball Menschen und Orte auf ungewohnte Weise miteinander. Einige rollen ihn, unter großem Gelächter, durch die Straßen. Andere legen sich unter den Ball und lassen sich überrollen, eigentümlicherweise vor allem Männer im Anzug.
"Übermannshohe schwarze Kugel aus gefilzter Merinowolle rollt durch Lienzingen" vollständig lesen