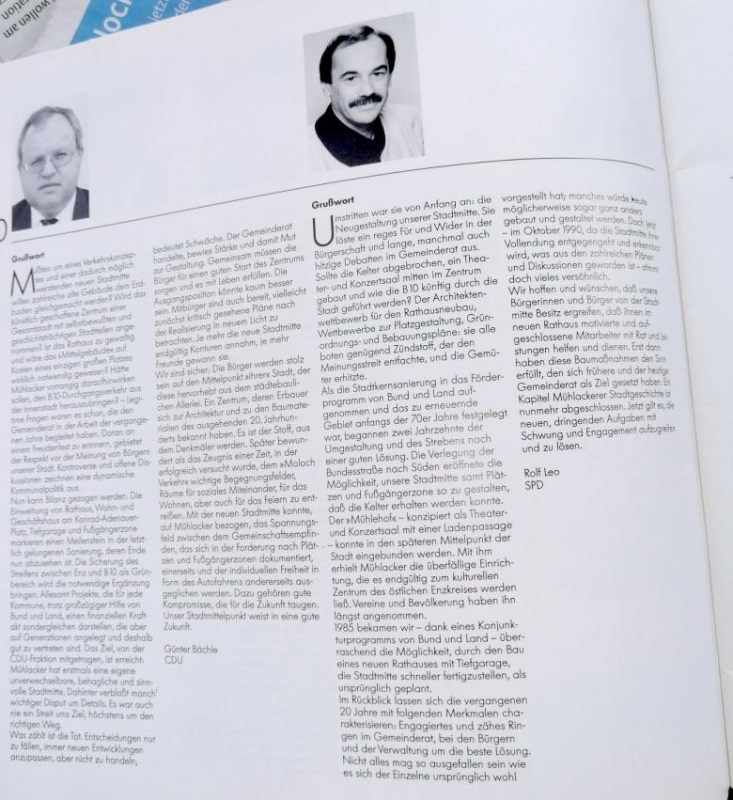Auf den Spuren, die zum Loch führten
Und wieder wussten es so viele besser. Ein guter Grund fehle, um in Mühlacker einkaufen zu gehen, zitierte die Pforzheimer Zeitung ausgerechnet die Familie Sämann, nachdem diese angekündigt hatte, ihr Kaufhaus in der unteren Bahnhofstraße zu schließen. Ganz und gar nicht dieser Ansicht ist Leo Vogt vom Modegeschäft Schwesterherzen in der mittleren Bahnhofstraße. Das muss doch einen Grund haben. Pessimist der eine, Optimist der andere? Vielleicht Optimist, weil er Ideen hat, neue Wege wagt, um Kundschaft zu gewinnen und zu halten.
Wohl dem, der seine wirtschaftliche Malaise auf andere, vor allem die Kommunalpolitik abzuschieben versteht. Und da sind noch die medialen Kommentatoren, die Überschriften produzieren wie Fußgängerzone: Verpasste Chancen, gute Ideen. Und flugs Ist sie da, die Mutter aller Zentrumsprobleme - das Mühlehof-Loch. Das Arial neben dem Rathaus, über der Tiefgarage liegend. Einer Skaterbahn ähnlich.

Begeben wir uns auf die Spuren, die zum Loch führten. Ein beliebtes Thema, wie sich zurzeit auch an Informationsständen der Gemeinderatsfraktionen zur Kommunalwahl am 9. Juni 2024 zeigt. Manche/r trauert noch dem Saal nach, andere dem gebrochenen Wort von Räten, weil die zugesagte Stadthalle immer noch nur auf dem Papier steht obwohl real fest zugesagt.
Unsere Zeitreise beginnt 2011: Erstmals gehörte der Mühlehof vollständig der Stadt, erworben zum symbolischen Preis von einem Euro von der Firma Echo aus Berlin, die vor der Sanierungsaufgabe kapitulierte – was manche heute noch verdrängen wollen. Eine von der Stadt beauftragte Machbarkeitsstudie von Dress & Sommer aus Stuttgart gab die Kosten für eine Rund-um-Erneuerung mit 30 Millionen Euro brutto an.
Was tun? Bei einer Bürgerversammlung am 30. Juni 2011 mit etwa 450 Besuchern ging es im Mühlehof-Saal um die Zukunft des Mühlehofs, ums Einkaufen in der Innenstadt und das Kulturangebot in Mühlackers Zukunft. Führungen durch das Gebäude, Blicke hinter die Kulissen – alles sollte der Meinungsbildung dienen. Ein Internetforum ließ die Stadt auch freischalten.
Irgendwie alles schon einmal dagewesen.
"Auf den Spuren, die zum Loch führten" vollständig lesen