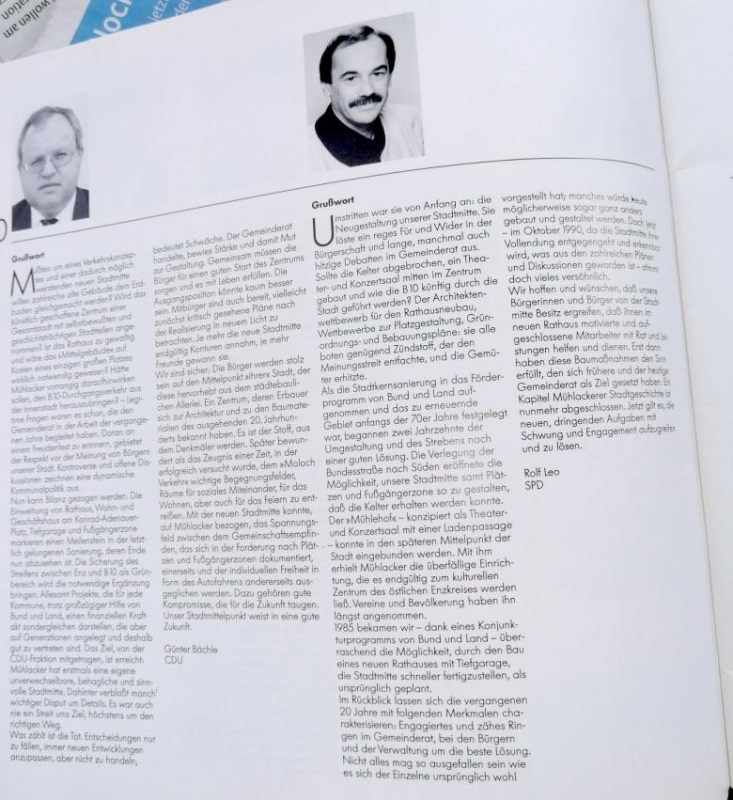Elektronische Post aus Karlsruhe legte sich zwei Tage vor Heiligabend in meinem Mail-Eingang ab. Ein Weihnachtsgeschenk? Die Antwort von Regierungspräsidentin Sylvia Felder zur geplanten neuen Herrenwaagbrücke in Mühlacker-Dürrmenz lässt hoffen, dass die damit verbundenen Belastungen für Autofahrer doch nicht so ganz heftig ausfallen werden wie befürchtet: In drei Mails an die Behördenchefin packte ich für die CDU-Fraktion im Gemeinderat Anregungen aus der Bürgerschaft zum vorgesehenen Ablauf der Baustelle, die auch aufgearbeitet wurden. Die Arbeiten sind vergeben, sollen im März oder April 2021 starten. Der Unmut der Betroffenen, monatelang für die relativ kurze Tour von und nach Mühlacker über Lomersheim und Pinache gondeln zu müssen, ist in Gesprächen und Briefen zu spüren.
Zudem war bisher eine durchgängige Kommunikationsstrategie des in Karlsruhe in Schloss-Nähe residierenden Präsidiums nicht zu entdecken gewesen, auch wenn die Planung auf der Internetseite des RP steht und zwar mit elektronischer Anlaufadresse. Kommunikation und ernsthafte Prüfung von alternativen Vorschlägen gehöre nicht zu den starken Seiten der Planer. Dieser Eindruck festigten in Mühlacker etwa Leserbriefschreibern. Doch Felder kündigte in ihrer Antwort an, nachzubessern. Als frühere Landtagsabgeordnete sowie Kreis- und Stadträte weiß sie, wie nahe am Volk Kommunalpolitik arbeitet.
Nein zu einem RP-Bashing, Ja zu einer konstruktiven Diskussion. Denn wir haben ein starkes Interesse daran, dass die erneut 2014 als marode eingestufte Brücke ersetzt und damit auch ein Engpass entschärft wird, wenn die Enz Hochwasser führt. In einer fast unendlichen Geschichte soll nun der Schlusspunkt gesetzt werden. Vor allem an Weihnachten 1993 litten die Dürrmenzer durch Überschwemmungen darunter. Deshalb plädiere ich dafür, die Terminpläne einzuhalten. Denn endlich ist das Projekt finanziert. Jahrelang gab es Ankündigungen, für die wir uns nichts kaufen konnten. Immerhin liefen die Planungen weiter, sie waren in öffentlichen Sitzungen des zuständigen Gemeinderatsausschusses jeweils vorgestellt und im Großen und Ganzen abgesegnet worden. Und die Konkurrenz ist groß.
Technische Details der jetzigen, im Jahr 1946 eingeweihten Brücke: ein dreistegiger gevouteter Plattenbalken über drei Felder, 55 Meter lang und 8,30 Meter breit. Nebenbei: Diese Daten finden sich sich auf einer eigenen Web-Seite über alle Brücken, die über die Enz gespannt sind. 42 zwischen Neuenbürg und Besigheim sind gelistet. Darunter jene bei Vaihingen im Zuge der B10, die nach Jahren der Bauzeit - zuerst ein Provisorium, dann der jetzige neue Übergang für etwa siebeneinhalb Millionen Euro - vor Weihnachten freigegeben wurde. Wer sich erinnern mag: Die alte Brücke war 2014 wegen akuten Sanierungsbedarfs aus Sicherheitgründen von einem Tag auf den anderen halbseitig gesperrt wurde. Das Land hatte die Sanierung immer wieder verschoben. Die Zeche bezahlten die Autofahrer. Mich hatte es auch erwischt, denn mein Arbeitsplatz war in Ludwigsburg. Die Sperrung kam Knall auf Fall, da konnten vorher keine passablen Umleitungsstrecken ausgetüfelt werden. Ganz anders jetzt bei der Herrenwaagbrücke.
Im Oktober 2010 gaben Fachleute des Landes Baden-Württemberg für den Straßenbau der Herrenwaagbrücke nur noch die Note 3,3. Dieser Enzübergang in Dürrmenz, Teil der Landesstraße 1134, war auf dem Prüfstand. Dabei zeigten sich erhebliche Mängel, die mittelfristig einen Ersatzbau notwendig machen. Das ließ sich einem Schreiben der baden-württembergischen Umwelt- und Verkehrsministerin Tanja Gönner an den seinerzeitigen Enzkreis-Vertreter, Winfried Scheuermann, entnehmen. Wir hofften auf einen neuen Überweg schon für die Zeit vor der Gartenschau 2015. Doch die Rechnung ging nicht auf.
Aber jetzt wird es ernst. Das Erreichte darf nicht verspielt werden. Zentraler Punkt des jetzigen Briefwechsels zwischen der Regierungspräsidentin und mir: Die Vollsperrung des Enz-Übergangs entweder zu vermeiden oder zumindest zeitlich zu reduzieren. Bisher war von 4,5 bis 6 Monaten Trennung zwischen Dürrmenz und Mühlacker die Rede. Felder nahm Anregungen auf, stellte differenziert diese Baumaßnahme und das Bemühen dar, die Zeit der durch eine Vollsperrung des Enz-Übergangs notwendigen Umleitung zu minimieren. Gleichzeitig griff sie den Vorschlag der Fraktion für eine Bürgerinformation im Januar 2021 auf.
Hier die durchaus inhaltsschwere Nachricht aus Karlsruhe im Originaltext:
"Die Präsidentin zum Herrenwaag-Terminplan: Bauphase der neuen Enz-Brücke wird zeitlich so kurz wie möglich gehalten " vollständig lesen