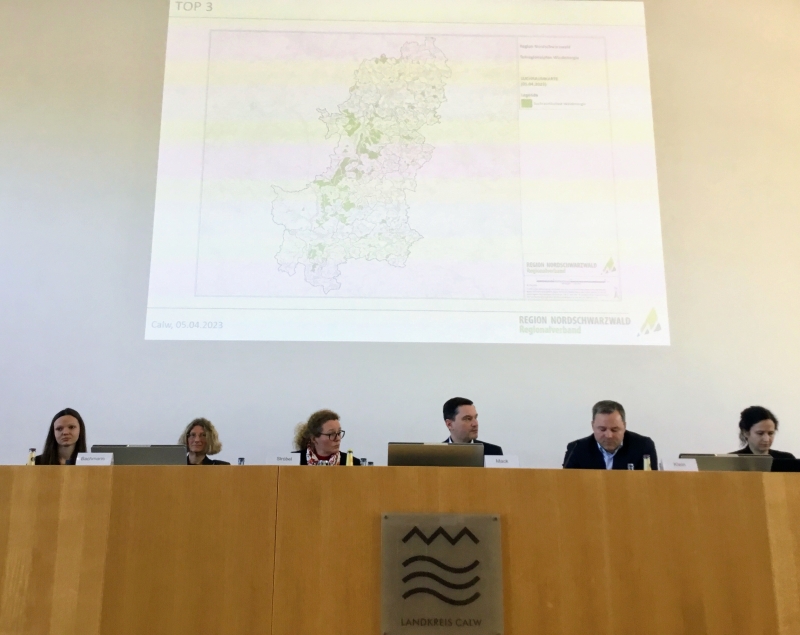Seit der im Jahr 2020 vom Landtag beschlossenen Verschärfung des Naturschutzgesetzes leitete die Mühlacker Baurechtsbehörde insgesamt gegenüber fünf Eigentümern von Grundstücken mit Schottergärten ein förmliches Verfahren ein. Das geht aus der Antwort von Bürgermeister Winfried Abicht auf meine Gemeinderatsangfrage hervor. Angesichts des relativ kurzen Zeitraums und der geringen Anzahl von Fällen könne noch keine statistisch aussagekräftige Aussage zur Entwicklung der Zahl der Schottergärten getroffen werden.
Dabei bezog ich mich auf Beratungen des Gemeinderates im Jahr 2018 zu diesem Thema und wollte wissen, welche Erfahrungen die Stadtverwaltung inzwischen gemacht habe. Ich wurde in jüngster Zeit mehrfach von Leuten angesprochen, die den Eindruck haben, das Problem nehme zu. Sogenannte Schottergärten werden, so 2018 vom Gemeinderat beschlossen, in neuen Bebauungsplänen ausgeschlossen, erinnerte Abicht. Eine allgemeine Satzung zum Ausschluss von Schottergärten gab und gibt es dagegen nicht, so der Bürgermeister. Sie wäre auch vor dem Hintergrund der zwischenzeitlichen Neufassung des Paragrafen 21a des baden-württembergischen Naturschutzgesetzes vom Juli 2020 nicht mehr erforderlich, weil seither eine eindeutige und vollziehbare gesetzliche Regelung existiere.
Der Vollzug der gesetzlichen oder bauleitplanerischen Regelungen sei abhängig von der Kenntnis der Baurechtsbehörde über entsprechende Verstöße, steht in der Antwort aus dem Rathaus. Soweit die Baurechtsbehörde durch eigene Feststellungen oder Anzeigen Dritter Kenntnis über die Anlage von Schottergärten erlange, würden die Eigentümer zum Rückbau aufgefordert. Häufig würden sie Rechtsmittel gegen die Anordnungen der Baurechtsbehörde einlegen. Infolgedessen greife der vorläufige Rechtsschutz, wodurch die Anordnungen bis zur abschließenden Überprüfung der Sach- und Rechtslage zunächst nicht befolgt werden müssen.
Die Baurechtsbehörde hat laut Bürgermeister den Schottergarten auf einem Grundstück an der Danziger Straße im Juni 2020 aufgegriffen. Da zum Zeitpunkt der Errichtung des Schottergartens die Änderung des Naturschutzgesetzes noch nicht gegolten habe, konnte lediglich aufgrund des geltenden Bebauungsplans Bannholz Nord durchgesetzt werden, dass im Vorgarten ein standortheimischer Laubbaum gepflanzt wird, beschreibt Abicht das Ergebnis.
Mit der Problematik der Anlage von Steinbeeten, Schottergärten oder ähnlichen Materialschüttungen mit allenfalls spärlicher, in der Regel zudem exotischer Bepflanzung ist die Verwaltung im Bereich der Gestaltung von Vorgärten zunehmend konfrontiert, hatte sie schon 2018 im Gemeinderat dargelegt. Diese Gärten, die häufig aus Gründen einer vermeintlichen Pflegeleichtigkeit angelegt würden, seien in ihrer ökologischen und stadtgestalterischen Wirkung (insbesondere Klimaausgleich, Artenvielfalt und Straßenraumgestaltung) eher mit versiegelten Flächen als mit bepflanzten Flächen gleichzusetzen, so die Stadtverwaltung. (bä)