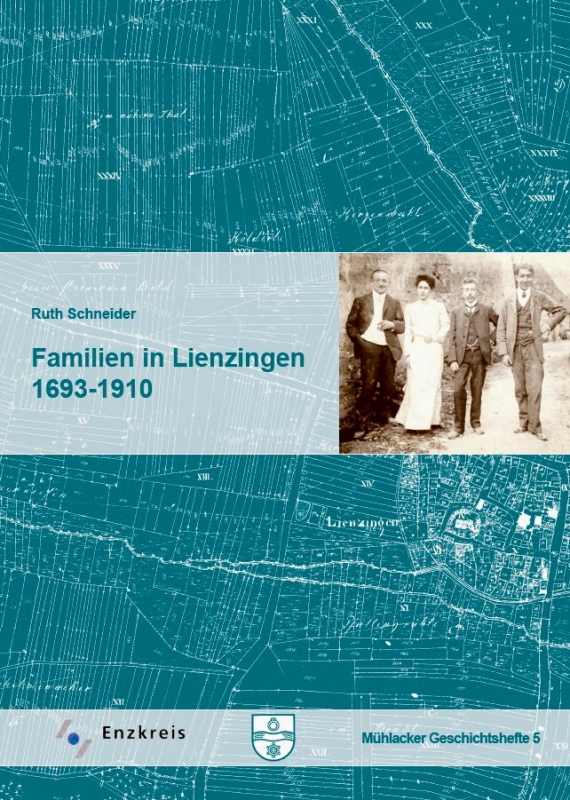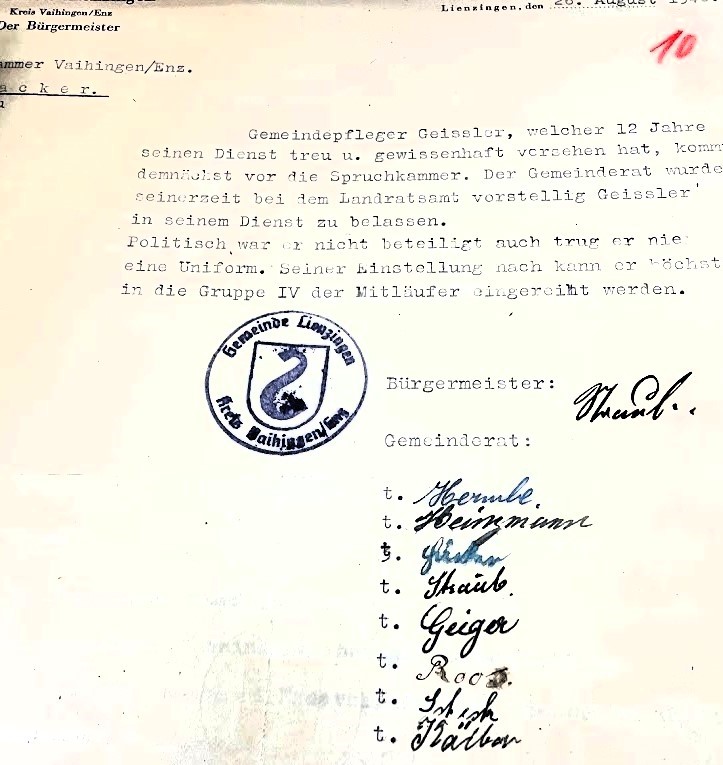Junger Lokalredakteur im Kreis Ludwigsburg, zudem politisch interessiert, neugierig auf die zeitweise Mächtigen, der sich was traut, die Einflussreichen in einem demokratischen System beobachtet und die Kritik auch an ihnen nicht scheut. Doch die Nähe zu ihnen droht, auch einmal eine Fünf gerade sein zu lassen.
Einen Vorgeschmack erhielt ich am 26. Juni 1969 in der Stromberghalle in Illingen, noch Volontär bei der Pforzheimer Zeitung. Dort zeigte mein Kollege Leo Spielhofer, Redakteur des Württembergischen Abendblattes/Pforzheimer Zeitung, sein journalistisches und organisatorisches Talent: Er stellte einen Diskussionsabend mit Sicco L. Mansholt (Vize-Präsident der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft) auf die Beine – der Saal war rappelvoll, denn der Holländer galt als Feindbild der deutschen Landwirte schlechthin. Mansholt trieb angeblich Politik gegen die Familienbetriebe, Gütesiegel der Bauern im Südwesten Deutschlands. Ich jedenfalls war fasziniert, was Zeitung kann. Dann: Zum 1. Juli 1971 Wechsel zur Ludwigsburger Kreiszeitung.
 Die Neuen genossen das journalistische Allerlei im Kreis Ludwigsburg, die Vielfalt, das Abwechslungsreiche. Denn hier, auf die Bevölkerungszahl umgerechnet, wohnten und agierten vor allem in den siebziger bis neunziger Jahren prozentual wohl die meisten Mitglieder der Landesregierung und Fraktionschefs. Lothar Späth – vom Bietigheimer Bürgermeister zum Ministerpräsidenten, seine heimlichen Strippenzieher wie der Staatssekretär und Regierungssprecher Matthias Kleinert aus Besigheim oder Erich Griesinger, Gemeinderat im benachbarten Löchgau und derjenige, der darauf achtete, dass im Landkreis die Christdemokraten nicht aus dem Ruder liefen. Schließlich Annemarie Griesinger, zuerst Arbeits- und Sozial-, dann Bundesratsministerin, die gute Seele der Union aus Markgröningen, die das Lächeln exakt anknipsen konnte wie andere das Licht. Später Annette Schavan, aus dem Rheinland geholte Kultusministerin, die sich eine kleine Wohnung in Bietigheim nahm. Der Kreis Ludwigsburg als heimliche Machtzentrale der Landespolitik: Und wir mittendrin. Junge, neugierige, interessierte Redakteure.
Die Neuen genossen das journalistische Allerlei im Kreis Ludwigsburg, die Vielfalt, das Abwechslungsreiche. Denn hier, auf die Bevölkerungszahl umgerechnet, wohnten und agierten vor allem in den siebziger bis neunziger Jahren prozentual wohl die meisten Mitglieder der Landesregierung und Fraktionschefs. Lothar Späth – vom Bietigheimer Bürgermeister zum Ministerpräsidenten, seine heimlichen Strippenzieher wie der Staatssekretär und Regierungssprecher Matthias Kleinert aus Besigheim oder Erich Griesinger, Gemeinderat im benachbarten Löchgau und derjenige, der darauf achtete, dass im Landkreis die Christdemokraten nicht aus dem Ruder liefen. Schließlich Annemarie Griesinger, zuerst Arbeits- und Sozial-, dann Bundesratsministerin, die gute Seele der Union aus Markgröningen, die das Lächeln exakt anknipsen konnte wie andere das Licht. Später Annette Schavan, aus dem Rheinland geholte Kultusministerin, die sich eine kleine Wohnung in Bietigheim nahm. Der Kreis Ludwigsburg als heimliche Machtzentrale der Landespolitik: Und wir mittendrin. Junge, neugierige, interessierte Redakteure.
Baden-Württemberg, das war CDU-Land. Von den seinerzeitigen absoluten Mehrheiten wie sie Hans Filbinger und Späth holten, kann die heutige Unionsgarde nur träumen. Aber das waren Zeiten, als für die Union noch Namen standen. Zum Beispiel der Uni-Professor Wilhelm Hahn als Kultusminister oder Robert Gleichauf, der Mechanikermeister aus dem katholischen Rottenburg, der es bis zum Finanzminister schaffte, wohl den besten, den das Ländle je hatte. Der sich auch hier als Familienvater empfand, der solide wirtschaftet, keine ungedeckten Schecks – auch nicht im übertragenen Sinne – unterschreibt.
Im November 1976 erlebte ich ihn in Bietigheim, als er Wahlkampf für den in Beilstein wohnenden Professor an der Ludwigsburg PH, Wilhelm Walter, machte. Walter sollte bei der anstehenden Bundestagswahl den von Annemarie Griesinger bis zu ihrem Wechsel in die Landesregierung gehaltenen Bundestagssitz verteidigen, doch er unterlag dem Sozialdemokraten Gunter Huonker, Wahl-Ludwigsburger und ansonsten Bad Godesberger. Für Matthias Wissmann kam die Sache zu früh, der angehende Jurist war in Bonn neben dem Studium persönlicher Mitarbeiter von Annemarie Griesinger, zudem Bundesvorsitzender der Jungen Union – der junge Mann vom Ludwigsburger Zuckerberg soll mehr sich in den Medien vermarktet haben als seine Chefin Annemarie, was sicherlich ihr nicht schadete, jedoch seiner Karriere guttat, die ihn dann doch noch in den Bundestag und dann unter Helmut Kohl in die Bundesregierung führte.
"Fasziniert, was Zeitung kann - Heimliche Machtzentrale der Landespolitik: Und wir mittendrin" vollständig lesen