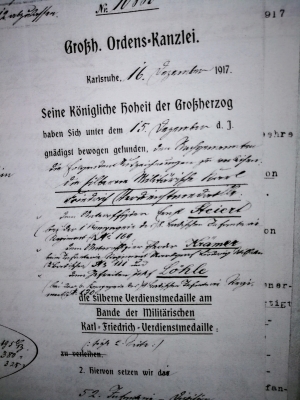Von der Ersparungs-Classe bis zum Stabilitätsanker - Wider die Trägheit
Polit-Prominenz im Achterpack. Ein solches Erlebnis gibt es nicht alle Tage. Diese Woche schon, und zwar an zwei Tagen in den Hallen 19/20 der Messe Hannover ' bei dem alle drei Jahre stattfindenden Deutschen Sparkassentag. Zwar waren die eher an Gartenstühlchen erinnernden Sitzgelegenheiten alles andere als angenehm, doch der Bequemlichkeitsverlust erschien in diesem Fall hinnehmbar als Preis für das Programm: Zu hören und zu sehen nacheinander einen Ministerpräsidenten, einen Ex- Bundespräsidenten, den Kanzler, seinen Vizekanzler, den Oppositionsführer, den Bundesfinanzminister, nicht zuletzt die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), eine russische Bürgerrechtlerin nebst Professor aus Chicago.

An die 2700 Menschen beim 27. Deutschen Sparkassentag, darunter Vorstandsmitglieder und Verwaltungsräte. Die Arena-Bestuhlung lässt wenig Zwischenraum, ordnet jedem Besucher einen festen Sitzblock zu, getrennt durch versetzte Treppen. Inklusion ist anders. Doch sie erlaubt einen Einzug wie bei einem Boxkampf. Moderatorin Gundula Gause als Arena-Sprecherin schaltet in den Laut-Modus um, was ihr in Maßen gelingt: Wir begrüßen den Kanzler! Die Menschen stehen auf wie auf kollektivem Geheiß, klatschen, doch von den oberen Seitenrängen lässt sich Olaf Scholz in dem ihm folgenden Menschenpulk kaum erkennen. Anderntags bei Christian Lindner ist es nicht viel besser, die hochgewachsene Christine Lagarde ragt da schon eher heraus. Den Dreien nur lassen die Veranstalter des Kongresses dieses Spektakel angedeihen. Die anderen Redner finden sich ohne Tam-Tam in der ersten Reihe

ein. Sie betreten die Halle durch den Seiteneingang, nicht durch die hohle Gasse, in der Mitte.
1778 die erste Sparkasse gegründet
Wer bei den Sparkassen spricht, in dessen Rede ist auch Sparkasse drin. Fast alle Redner boten einen mehr oder minder kleinen Werbeblock für die mehr als 330 deutschen Sparkassen. Die Kette von Herausforderungen verunsichert die Menschen. Sie brauchen Stabilitätsanker. Das gilt für die Politik. Aber nicht nur: Die Sparkassen sind gesellschaftlicher Stabilitätsanker erster Güte – wir brauchen Sie in dieser Rolle! Worte von Stephan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen. 200 Jahre alt wird dieses Jahr die Sparkasse Hannover. Der Bundeskanzler reklamierte Hamburg als Ort der ältesten, 240 Jahre alten Sparkasse.
Gauck bestätigte: Die Sparkassenidee ist nicht an der Leine, sondern an der Elbe entstanden. Bereits 1778 sei auf Initiative der Patriotischen Gesellschaft in Hamburg die Ersparungs-Classe gegründet worden. Sie ist – so zitiere er kurz aus der damaligen Satzung – zum Nutzen geringer fleißiger Personen beiderlei Geschlechts, als Dienstboten, Tagelöhner, Handarbeiter, Seeleute, errichtet, um ihnen die Gelegenheit zu bieten, auch bei Kleinigkeiten etwas zurückzulegen und ihren sauer erworbenen Not- und Brautpfennig sicher zu einigen Zinsen belegen zu können, wobei man hoffet, dass sie diese ihnen verschaffte Bequemlichkeit sich zur Aufmunterung gereichen lassen mögen, um durch Fleiß und Sparsamkeit dem Staate nützlich und wichtig zu werden.
"Von der Ersparungs-Classe bis zum Stabilitätsanker - Wider die Trägheit" vollständig lesen
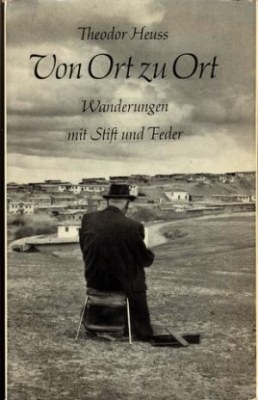 Für
Für