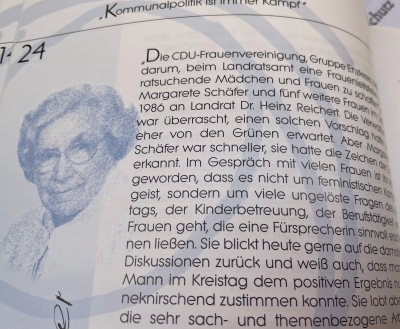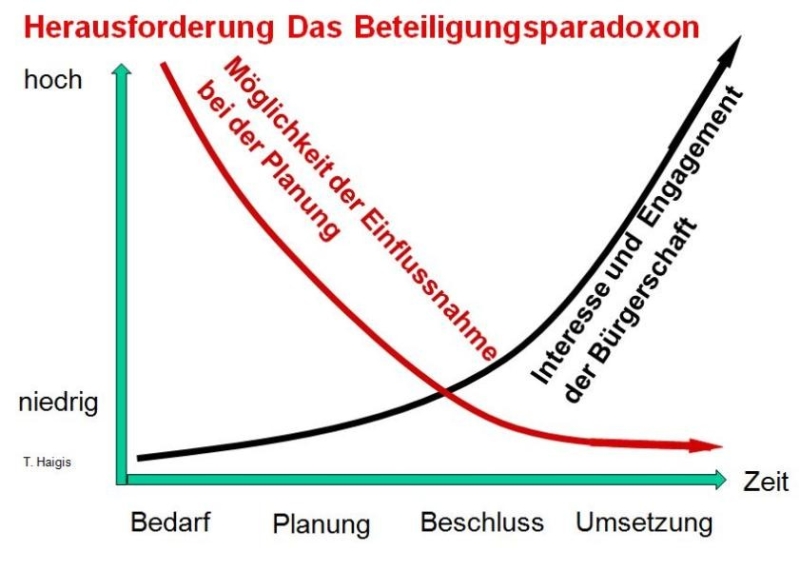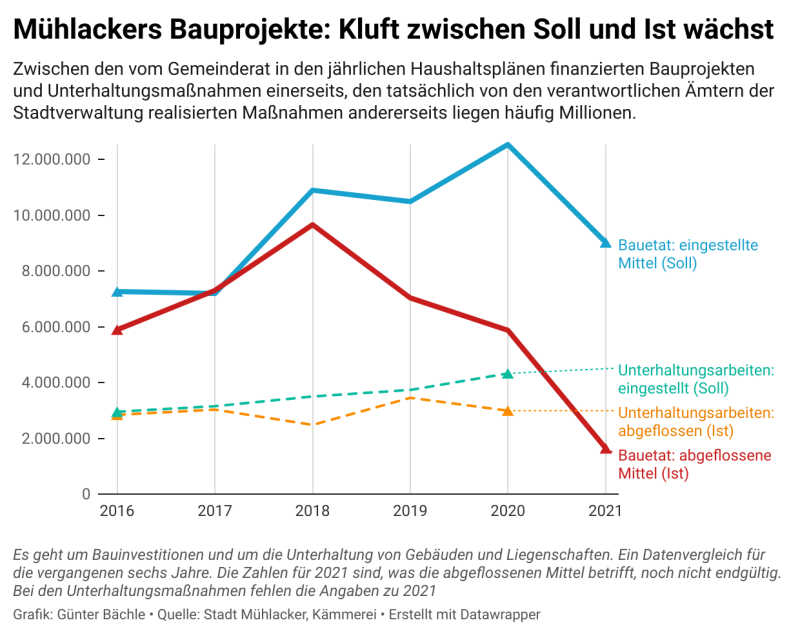Brücke, Buch und Bringschuld
Seit 21 Monaten dauern die Arbeiten am Neubau der Herrenwaagbrücke in Mühlacker plus zweier neuer Kreisverkehre beidseits der Enz-Querung sowie der Sanierung der Herrenwaagstraße, der Straße Unterm Berg und der Enzstraße. So ruhig rollten die Fahrzeuge noch nie über die Herrenwaagstraße, seit dort der neue Belag aufgebracht ist.

Auch wenn sich trotzdem Ärger und Verdruss wegen Umleitungen oder als unzureichend empfundener Informationspolitik der bauenden Landesbehörden bei vielen Menschen festsetzten – Hand aufs Herz: Ein reibungsloser Ablauf wäre wünschenswert gewesen, doch eigentlich rechneten die wenigsten damit. Man sieht es mit bloßem Auge: Eng geht es zu auf der Baustelle, wenig Rangierraum. Dafür sorgen Zwangspunkte wie die Bebauung. Das geht eben nicht: Wasch mir den Pelz… .
Seit voriger Woche sind auch keine Straßen mehr gesperrt. Zitat Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe: Wie geplant wird es bis zur Verkehrsfreigabe der neuen Brücke im kommenden Jahr keine weiteren zusätzlichen Einschränkungen für den Verkehr geben. Die Baustellenampel an der Einmündung der Straße „Unterm Berg“ bleibt in Betrieb.
Heute schaute ich mir die Baustelle an, beobachtete die Enz, erinnerte mich an das Weihnachtshochwasser 1993, unter anderem auch Folge des unzureichenden Durchfluss-Querschnitts unter der alten Brücke, weshalb die neue auch vordringlich war.
"Brücke, Buch und Bringschuld" vollständig lesen